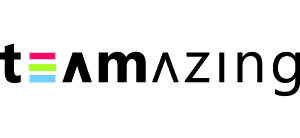Als Resilienz (lat. resilire für zurückspringen, abprallen) bezeichnet man die mentale Widerstandsfähigkeit, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen.
Im Detail meint Resilienz nicht das „Abprallen“ von stressigen Lebenssituationen oder Schicksalsschläge, sondern viel mehr verfügen resiliente Menschen über die nötige Kraft und das Selbstbewusstsein, an Krisen und Problemen zu wachsen und aus solchen Situationen gestärkt hervorzugehen.
Resilienz Definition
Resilienz bezeichnet die Fähigkeit einer Person, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen, sich an Veränderungen anzupassen und gestärkt aus Herausforderungen hervorzugehen. Es handelt sich um eine psychische Widerstandsfähigkeit, die es ermöglicht, Rückschläge und Stresssituationen zu überwinden, ohne dabei nachhaltig geschädigt zu werden. Resiliente Menschen zeigen die Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen, sich anzupassen und ihre mentale Gesundheit zu erhalten. Diese Eigenschaft ist nicht angeboren, sondern kann durch verschiedene Strategien und persönliche Entwicklungsprozesse gestärkt werden.
Beispiel:
Nehmen wir Malala Yousafzai, die pakistanische Bildungsaktivistin als Beispiel. Nachdem sie von den Taliban angegriffen wurde, setzte sich Malala unermüdlich für das Recht auf Bildung von Mädchen ein. Trotz der Bedrohungen und des Angriffs auf ihr Leben zeigte sie erstaunliche Resilienz. Statt sich von der Gewalt einschüchtern zu lassen, setzte sie sich weiterhin für Bildung und Frauenrechte ein, wurde 2014 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und baute ihre Bemühungen weiter aus. Ihr Beispiel illustriert eindrucksvoll, wie Resilienz dazu führen kann, selbst in extrem schwierigen Umständen widerstandsfähig zu bleiben und positive Veränderungen voranzutreiben.
Hochsensibilität, Vulnerabilität & Resilienz
Im Zusammenhang mit Resilienz, hört man auch sehr oft die Begriffe Vulnerabilität & Hochsensibilität.
Hochsensibilität
Hochsensibilität ist ein Wesenszug. Es impliziert eine feinere Wahrnehmung. Das heißt hochsensible Menschen reagieren empfindlicher auf Reize und verarbeiten Informationen intensiver als andere. Hochsensible Menschen sind, aufgrund ihrer Wahrnehmung, oft sehr schnell reizüberflutet. Dies hat zur Folge, dass sich schnell ein Unwohlsein auftut, wenn mehrere Dinge gleichzeitig passieren oder wenn es im Umfeld etwas hektischer zugeht. Sie lassen sich sehr oft von der Stimmung anderer Personen beeinflussen.
Vulnerabilität
Vulnerabilität gilt in der Psychologie als Gegenteil von Resilienz. Ein hohes Maß an Vulnerabilität führt dazu, dass Menschen schneller emotional verletzt sind und sich oft ungerecht behandeln fühlen. Sie haben Probleme damit, Lösungen zu finden oder zuversichtlich zu sein.
Resilienz Geschichte: Emmy Werner und die Resilienzforschung
In der Resilienzforschung gilt vor allem Emmy Werner, eine amerikanische Entwicklungspsychologin, als wahre Wegbereiterin. Bahnbrechend war dabei die Kauai–Studie. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ruth Smith begleitete sie 698 Kinder auf der hawaiianischen Insel Kauai. 1977 wurde diese Studie veröffentlicht und damit wurde – wenig überraschend – klar, dass sich Kinder, die biologischen und sozialen Risikofaktoren (Armut, Suchmittelmissbrauch der Eltern, Gewalt u.dgl.) ausgesetzt waren, negativer entwickelten als die Kinder, die solchen Umständen nicht ausgesetzt waren.
Das Herausragende dieser Studie war allerdings, dass sich dennoch ein Drittel jener Kinder, trotz Risikofaktoren, positiv entwickelten. Sie waren schulisch und später beruflich erfolgreich, hatten sozialen Anschluss und wiesen in Summe eine positive Entwicklung auf – sie waren resilient.
Mit diesem Ergebnis tat sich die Frage auf: „Was sind die Gründe für eine derart positive Entwicklung, trotz aller negativen Umstände?“
Werner und Smith kamen zum Ergebnis, dass jene Kinder eine Sache gemeinsam hatten: eine vertraute Bezugsperson, die ihnen Orientierung und Zuversicht bot und Grenzen setzte!
Die 7 Säulen der Resilienz
Die “7 Säulen der Resilienz” sind ein Konzept, das verschiedene Aspekte und Fähigkeiten umfasst, die zur Entwicklung von psychischer Widerstandsfähigkeit beitragen. Wir erklären die Säulen im Detail:
1. Selbstwirksamkeit:
Selbstwirksamkeit bezieht sich auf die Überzeugung, dass man in der Lage ist, Einfluss auf sein eigenes Leben zu nehmen und Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.
- Selbstvertrauen aufbauen: Resilienztraining konzentriert sich darauf, das Selbstvertrauen zu stärken, indem man seine Fähigkeiten und Ressourcen realistisch einschätzt und Erfolge feiert.
- Proaktives Handeln: Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit neigen dazu, proaktiv nach Lösungen zu suchen, anstatt passiv auf Schwierigkeiten zu reagieren.
2. Selbstregulation:
Selbstregulation bezieht sich auf die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, zu verstehen und konstruktiv darauf zu reagieren.
- Achtsamkeitspraktiken: Resilienztraining integriert Techniken wie Meditation und Achtsamkeit, um Emotionen bewusst zu erleben und effektiv damit umzugehen.
- Emotionale Intelligenz entwickeln: Menschen, die ihre eigenen Emotionen gut verstehen, können besser mit ihnen umgehen und sind oft einfühlsamer gegenüber anderen.
3. Optimismus:
Optimismus bedeutet, positive Erwartungen für die Zukunft zu haben und Schwierigkeiten als temporäre und beeinflussbare Herausforderungen zu sehen.
- Positive Psychologie: Resilienztraining verwendet Prinzipien der positiven Psychologie, um positive Denkmuster zu fördern und die Fähigkeit zu entwickeln, auch in schwierigen Zeiten Positives zu erkennen.
- Attributionstheorie: Menschen mit hoher Resilienz neigen dazu, negative Ereignisse externen Faktoren zuzuschreiben (temporär und nicht allumfassend), was zu einer optimistischeren Sichtweise führt.
4. Akzeptanz:
Akzeptanz bedeutet, schwierige Situationen und negative Emotionen anzunehmen, ohne sie zu leugnen oder zu unterdrücken.
- Radikale Akzeptanz: Resilienztraining kann Prinzipien der radikalen Akzeptanz einschließen, um Menschen zu helfen, unveränderliche Realitäten zu akzeptieren und den Fokus auf das zu lenken, was kontrollierbar ist.
- Achtsamkeit: Durch achtsame Praktiken lernt man, den gegenwärtigen Moment zu akzeptieren, ohne von Sorgen über die Vergangenheit oder die Zukunft überwältigt zu werden.
5. Netzwerkpflege:
Soziale Unterstützung und ein starkes soziales Netzwerk sind entscheidend für die Resilienz.
- Unterstützung suchen und bieten: Resilienztraining betont die Bedeutung, soziale Unterstützung zu suchen und anzubieten, um sich in schwierigen Zeiten nicht allein zu fühlen.
- Soziale Kompetenzen: Menschen, die in der Lage sind, effektiv mit anderen zu kommunizieren, Konflikte zu lösen und Beziehungen zu pflegen, neigen dazu, resilienter zu sein.
6. Zielfokus:
Zielfokus bezieht sich darauf, klare Ziele zu setzen und die Aufmerksamkeit darauf zu richten, anstatt sich auf Probleme zu konzentrieren.
- SMARTe Ziele: Resilienztraining lehrt die Formulierung von klaren, realistischen, messbaren, erreichbaren und zeitlich festgelegten Zielen.
- Motivation aufrechterhalten: Durch das Setzen von Zielen bleibt die Motivation erhalten, auch wenn Hindernisse auftreten.
7. Lösungsorientierung:
Lösungsorientierung bedeutet, sich auf Lösungen zu konzentrieren, anstatt sich auf Probleme zu fixieren.
- Problemlösungskompetenzen entwickeln: Resilienztraining fördert die Fähigkeit, konstruktive Lösungen zu finden, indem es den Fokus von den Hindernissen auf mögliche Wege zur Überwindung lenkt.
- Kreativität fördern: Menschen mit hoher Resilienz sind oft kreativ und flexibel in ihrer Denkweise, was es ihnen ermöglicht, neue Lösungsansätze zu entwickeln.
Resilienztraining
Die gute Nachricht: Resilienz kann trainiert werden! Resilienztraining ist ein Prozess, der darauf abzielt, die Fähigkeit einer Person zu stärken, mit Stress, Herausforderungen und Veränderungen konstruktiv umzugehen. Es ist eine Art mentaler Fitnesskurs, der darauf abzielt, die psychische Widerstandsfähigkeit zu verbessern.
Ziele von Resilienztraining
- Selbstbewusstsein stärken: Resilienztraining hilft, das Selbstbewusstsein zu fördern, indem es die Fähigkeit verbessert, die eigenen Stärken und Ressourcen zu erkennen.
- Emotionale Regulation: Durch das Training lernt man, Emotionen besser zu verstehen und zu kontrollieren, um in stressigen Situationen klar denken zu können.
- Problemlösungskompetenz entwickeln: Resilienztraining fördert die Fähigkeit, konstruktive Lösungen für Probleme zu finden und sich nicht von Schwierigkeiten entmutigen zu lassen.
- Soziale Unterstützung nutzen: Die Schulung beinhaltet oft Strategien zur Stärkung sozialer Beziehungen, da soziale Unterstützung ein wichtiger Faktor für Resilienz ist.
Methoden und Strategien von Resilienztrainings
- Achtsamkeitspraktiken: Das Training beinhaltet oft Übungen zur Achtsamkeit, um das Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment zu schärfen und Stress abzubauen.
- Positive Psychologie: Fokus auf positiven Aspekten des Lebens, Förderung von Optimismus und Dankbarkeit.
- Stressbewältigungstechniken: Vermittlung von praktischen Werkzeugen zur Bewältigung von Stresssituationen.
- Reflexion und Zielformulierung: Durch Selbstreflexion werden persönliche Ziele identifiziert, und Strategien zur Erreichung dieser Ziele werden entwickelt.
🏋️ Was ist ein Resilienz-Coach?
Ein Resilienz-Coach ist eine professionelle Person, die darauf spezialisiert ist, Menschen bei der Entwicklung und Stärkung ihrer psychischen Widerstandsfähigkeit zu unterstützen. Der Fokus eines Resilienz-Coaches liegt darauf, seinen Klienten Werkzeuge, Strategien und Fähigkeiten zu vermitteln, um besser mit Herausforderungen, Stress und Veränderungen umgehen zu können. Der Markt an Coaches dieser Art ist mittlerweile groß. Wir empfehlen wir daher, ein Resilienztraining oder -coaching nur bei professionellen Anbietern zu machen. Hier sind einige Aspekte, die seriöse Resilienz-Coaches charakterisieren.
- Individuelle Betreuung: Ein Resilienz-Coach arbeitet in der Regel eins zu eins mit seinen Klienten. Durch individuelle Sitzungen kann der Coach die spezifischen Bedürfnisse, Herausforderungen und Ziele der Person besser verstehen.
- Förderung von Bewältigungsstrategien: Der Resilienz-Coach unterstützt Klienten dabei, effektive Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Dies kann die Förderung von Selbstwirksamkeit, Achtsamkeitsübungen, positive Denkmuster und andere Techniken umfassen.
- Analyse von Stressoren: Coaches helfen dabei, die Hauptquellen von Stress und Druck im Leben des Klienten zu identifizieren. Dies ermöglicht eine gezielte Arbeit an den spezifischen Herausforderungen, denen die Person gegenübersteht.
- Förderung positiver Veränderungen: Resilienz-Coaches ermutigen ihre Klienten dazu, positive Veränderungen in ihrem Denken und Verhalten vorzunehmen. Dies kann dazu beitragen, eine optimistischere Perspektive zu entwickeln und konstruktive Handlungsweisen zu fördern.
- Stärkung sozialer Unterstützung: Der Coach kann daran arbeiten, die sozialen Unterstützungssysteme des Klienten zu stärken, sei es durch den Ausbau von sozialen Beziehungen oder die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten.
- Langfristige Perspektive: Resilienz-Coaches zielen darauf ab, langfristige Veränderungen zu bewirken, damit die Klienten auch in Zukunft besser mit den Herausforderungen umgehen können.
- Anpassungsfähigkeit: Da Resilienz in verschiedenen Lebensbereichen relevant ist, passen Resilienz-Coaches ihre Herangehensweise oft an die individuellen Bedürfnisse ihrer Klienten an. Dies kann Aspekte wie persönliche Entwicklung, beruflichen Erfolg oder Beziehungen umfassen.
Resilienz-Workshop
Als Team-Expert*innen liegt uns das Thema Widerstandsfähigkeit sehr am Herzen. Deswegen bieten wir einen intensiven Workshop an, der die Teamresilienz nachhaltig verbessert.
Resilienz im wirtschaftlichen Konnex
Da resiliente Personen mit Niederlagen, Rückschläge und stressigen Situationen besser umgehen können, ist es kaum verwunderlich, dass Resilienz vor allem im wirtschaftlichen Konnex einen hohen Stellenwert hat. Krisen sind unvermeidbar, vor allem im Zeitalter der Digitalisierung. Um in solchen Krisensituationen gut reagieren zu können und Gefahren frühzeitig zu erkennen, sollte ein jedes Unternehmen vorzeitig Maßnahmen treffen.
Um die Resilienz in einem Unternehmen zu gewährleisten, bedarf es einem Zusammenspiel individueller, Team- und organisationaler Resilienz.
Führungskräfte-Resilienz
Eine resiliente Führungskraft weiß um die eigenen Ressourcen Bescheid und hat eine vertrauensvolle Beziehung zu seinen Mitarbeitern. In Führung und Management gilt Resilienz als Kernkompetenz. Resiliente Führungskräfte sind eher in der Lage, flexibler auf Veränderungen zu reagieren.
Mitarbeiter-Resilienz
Resiliente Mitarbeiter*innen …
…können besser mit Druck und Stress umgehen.
…sind Optimisten.
…lassen sich gerne helfen und lernen aus eigenen Fehlern und denen der anderen.
…handeln selbstverantwortlich.
…sind sowohl physisch als auch psychisch gesund und dadurch leistungsfähiger und motivierter.
Organisationale Resilienz
Unter Organisationaler Resilienz versteht man die Fähigkeit eines Teams, sich in Zeiten der Veränderung anzupassen, um so als Organisation zu überleben und seine Ziele dennoch zu erreichen.
Resilienz vs. Teamresilienz
Während bei Resilienz meistens die Widerstandfähigkeit von Einzelpersonen beschreibt, befasst sich Teamresilienz mit der Art und Weise, wie Teams mit Rückschlägen und Hindernissen umgehen.
Wie kann Resilienz bereits im Kindesalter gestärkt werden?
Vorweg, Resilienz ist keine angeborene Eigenschaft, sie ist erlernbar. Resilienz ist ein andauernder Entwicklungsprozess. Resilienz kann verlernt werden und wieder neu erlernt werden. Bereits im Kindesalter wird die Basis für ein resilientes oder weniger resilientes Leben gelegt. Doch wie kann Widerstandsfähigkeit bzw. Resilienz bei Kindern bereits gestärkt werden?
- Kinder sollten zumindest eine enge Bezugsperson haben, die ihnen das Gefühl von Sicherheit und Zuversicht gibt.
- Eltern sollten als Vorbilder agieren, vor allem im Hinblick auf den Umgang mit Konflikten. Sie unterstützen ihre Kinder und leiten sie an.
- Kinder werden im Idealfall von ihrem Umfeld geachtet und wertgeschätzt und erhalten somit den Grundbaustein für ein gutes Selbstwertgefühl.
- Auch angenehme, positive Erfahrungen mit dem Umfeld, unterstützt Kinder dabei, ein resilientes Leben zu führen.